Grundpflege im Überblick – Definition, Leistungen und Tipps
Die Grundpflege umfasst die Unterstützung bei alltäglichen Grundbedürfnissen pflegebedürftiger Menschen: Körperpflege (Waschen, Anziehen), Hilfe bei Ausscheidung und Toilettengang, Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme sowie Mobilitätshilfen (Aufstehen, Lagern, Gehen). Ziel ist es, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und zur Selbstständigkeit anzuleiten, anstatt alles abzunehmen. Die Pflege wird von Angehörigen, Pflegediensten oder Betreuungskräften erbracht und ist eine Leistung der Pflegeversicherung. Wichtig sind gute Organisation, einfühlsamer Umgang und die Nutzung von Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige.
Im Überblick
Definition. Grundpflege umfasst die Unterstützung bei Körperpflege, Ernährung, Ausscheidung und Mobilität im Alltag.
Kosten. Die Grundpflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung. Sie erhalten Pflegegeld oder Pflegesachleistungen je nach Pflegegrad zwischen €332 und €2.095 monatlich.
Entlastung. Nutzen Sie Verhinderungspflege (€1.612/Jahr), Tagespflege und den Entlastungsbetrag (€125/Monat) für zusätzliche Unterstützung.
Was ist Grundpflege? – Definition und Bedeutung
Die Grundpflege bildet die Basis der Pflege für Menschen, die ihre alltäglichen Aufgaben nicht mehr allein bewältigen können. Darunter versteht man die Hilfe bei grundlegenden Grundbedürfnissen wie Körperpflege, Ernährung und Ausscheidung. Auch die Unterstützung der Mobilität zählt dazu, während hauswirtschaftliche Tätigkeiten (z.B. Putzen oder Kochen) separat betrachtet werden. Grundpflege wird oft auch als direkte Pflege oder Basispflege bezeichnet und umfasst alle regelmäßig wiederkehrenden Pflegemaßnahmen, die nötig sind, damit eine pflegebedürftige Person ihren Alltag bewältigen kann.
In der Praxis erhält jeder pflegebedürftige Mensch diese Form der Pflege – egal ob sie von einem ambulanten Pflegedienst, von pflegenden Angehörigen oder durch eine 24-Stunden-Betreuungskraft erbracht wird. Die Grundpflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung nach Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) und steht allen Versicherten mit anerkannter Pflegebedürftigkeit zu. Wichtig ist dabei, den Pflegebedürftigen nicht einfach passiv zu versorgen, sondern ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten anzuleiten und zu aktivieren. Das Ziel der Grundpflege ist es, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern: Es geht also nicht darum, dem Pflegebedürftigen die Zähne zu putzen, sondern ihn so zu unterstützen, dass er das Zähneputzen so weit wie möglich selbstständig durchführen kann.

Körperpflege: Hilfe beim Waschen und Anziehen
Ein zentraler Bestandteil der Grundpflege ist die Unterstützung bei der Körperpflege. Viele pflegebedürftige Menschen können sich nicht mehr vollständig alleine waschen, baden oder pflegen. Die Pflegeperson hilft daher je nach Bedarf beim Waschen einzelner Körperstellen oder übernimmt die Ganzkörperwäsche. Dazu gehören das Waschen des Gesichts und Oberkörpers, der Arme und Beine sowie der Intimbereiche. Die Körperpflege umfasst auch das Duschen oder Baden, wobei auf die Sicherheit geachtet wird (z.B. Nutzung eines Duschhockers oder Haltegriffs beim Duschen). Ebenso zählt die Haarpflege (Waschen, Kämmen, Trocknen, eventuell Aufsetzen von Haarersatz) und die Rasur zum Bereich Körperpflege. Nicht zuletzt beinhaltet sie die Zahnpflege und Mundhygiene – vom Zähneputzen bis zur Reinigung von Zahnprothesen. Viele dieser Pflegetätigkeiten kann der oder die Pflegebedürftige mit etwas Unterstützung oft teilweise selbst ausführen; was alleine nicht mehr gelingt, wird von der Pflegeperson übernommen.
Die Körperpflege kann je nach Situation an verschiedenen Orten erfolgen. Beispielsweise kann ein mobilerer Pflegebedürftiger am Waschbecken mithelfen, sich mit einem Waschlappen selbst zu waschen. Personen mit stärkerer Einschränkung werden häufig im Bett gewaschen (sogenannte Bettwäsche bzw. Ganzkörperwäsche im Bett). Alternativ ist auch eine Teilkörperpflege im Sitzen auf einem Duschstuhl oder am Waschbecken möglich. Wichtig ist, die Wäsche (frische Handtücher, Waschlappen, Kleidung) und alle Materialien (Waschschüssel, Seife, Cremes, Einmalhandschuhe etc.) im Vorfeld bereitzulegen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Nach dem Waschen trocknet die Pflegeperson die Haut gründlich ab und cremt sie bei Bedarf ein, um Hautproblemen vorzubeugen. Anschließend wird – falls nötig – beim Anziehen sauberer Kleidung geholfen (oder beim Umziehen in die Nachtwäsche am Abend). Auf Wunsch der pflegebedürftigen Person können auch weitere Hilfestellungen zur Körperpflege erfolgen, etwa Nagelpflege oder das Kämmen der Haare, sodass der oder die Betroffene sich wohl und gepflegt fühlt.
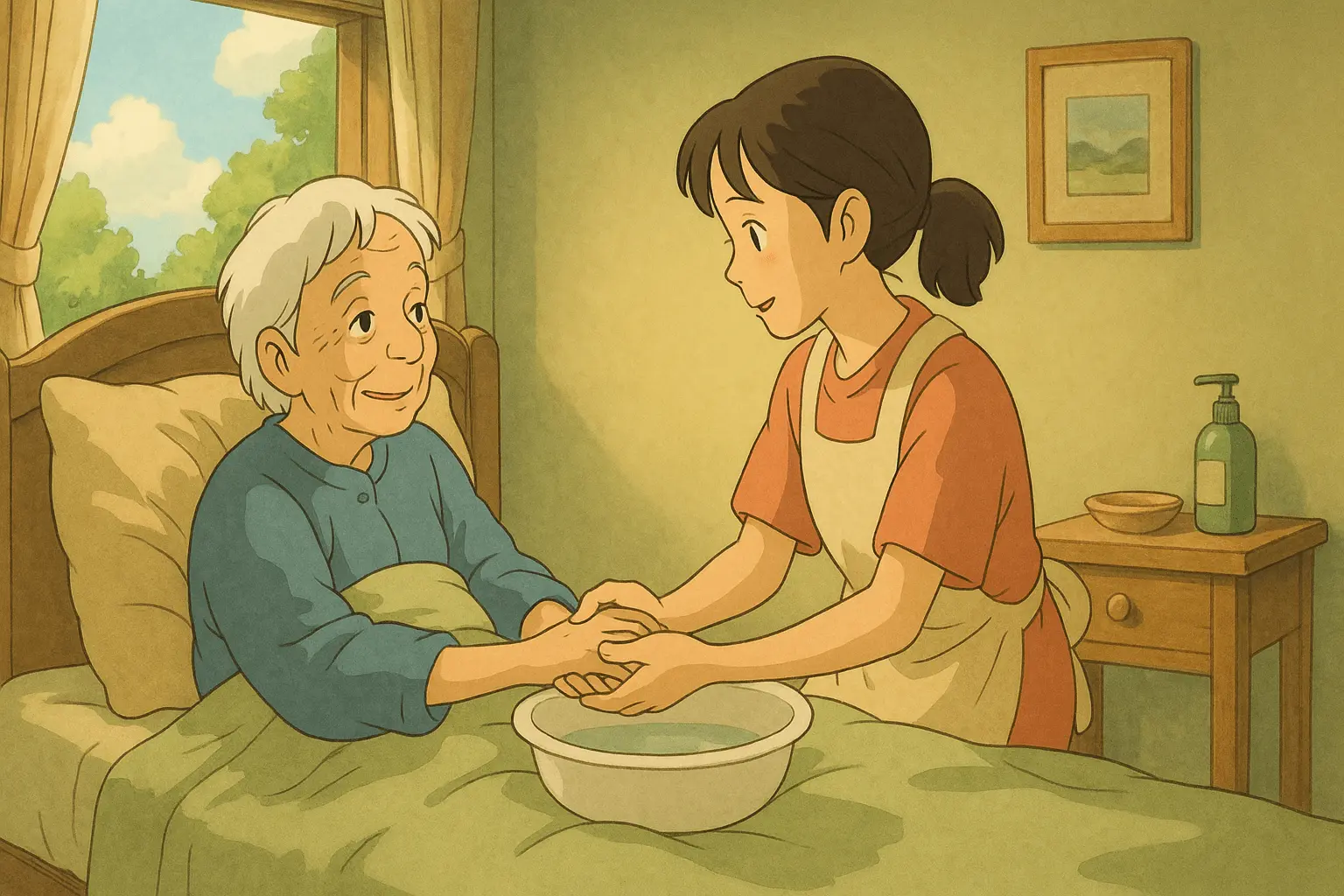
Ausscheidung: Unterstützung beim Toilettengang
Zur Grundpflege gehört auch die Hilfe bei der Ausscheidung, also beim Toilettengang und allen damit verbundenen Tätigkeiten. Pflegebedürftige Menschen benötigen hierbei unterschiedliche Unterstützung. Einige kommen mit minimaler Beaufsichtigung zurecht – etwa bei Unsicherheit beim Gang zur Toilette – während andere umfassende Hilfe benötigen. Die Pflegeperson hilft z.B. beim sicheren Transfer auf die Toilette oder den Toilettenstuhl und beim Entkleiden und Ankleiden. In der Regel bleibt sie in der Nähe, um bei Bedarf helfend einzugreifen. Nach dem Wasserlassen oder Stuhlgang übernimmt sie die Intimhygiene, also das sorgfältige Reinigen und Trocknen des Intimbereichs, um Hautreizungen und Infektionen vorzubeugen.
Auch der Wechsel von Inkontinenzmaterialien gehört zu diesem Bereich der Grundpflege. Kann die Person die Toilette nicht selbstständig benutzen oder ist inkontinent, wechselt die Pflegekraft regelmäßig Vorlagen oder Windeln und entsorgt diese hygienisch. Bei Bedarf werden auch Toilettenstühle entleert und gereinigt. Beispiel: Ist jemand aufgrund von Demenz oder Lähmungen auf Windeln angewiesen, sorgt die Pflegeperson je nach Zeitaufwand mehrmals täglich für das Wechseln der Einlagen, das Reinigen der Haut und das Eincremen zum Hautschutz. Zudem können spezielle Maßnahmen wie Kontinenztraining oder Toilettentraining unterstützt werden, um die Ausscheidungsfähigkeit möglichst zu verbessern. Falls ein Katheter oder ein künstlicher Darmausgang (Stoma) vorhanden ist, übernimmt die Pflegeperson auch hier die notwendigen Schritte – etwa Versorgung und Reinigung des Katheters oder das Wechseln des Stomabeutels. Insgesamt stellt die Hilfe bei der Ausscheidung sicher, dass der Pflegebedürftige würdevoll und sauber versorgt ist und Unfälle oder Infektionen vermieden werden.
Ernährung: Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme
Ein weiterer Bereich der Grundpflege ist die Ernährung, genauer gesagt die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme. Viele pflegebedürftige Menschen können nicht mehr selbstständig essen oder trinken – sei es aus körperlichen Gründen (z.B. Lähmungen, Zittern) oder aufgrund kognitiver Einschränkungen. Die Pflegeperson hilft daher, dass der Betroffene ausreichend Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Das beginnt bereits bei der Vorbereitung der Mahlzeiten: Die Speisen werden mundgerecht zugeschnitten und attraktiv angerichtet. Beispielsweise schneidet die Pflegekraft das Essen in kleine Stücke oder püriert die Kost, wenn Schluckbeschwerden bestehen.
Beim eigentlichen Essen leistet die Pflegeperson Hilfestellungen je nach Bedarf. Manche Pflegebedürftige brauchen nur Anleitung oder Motivation – etwa Erinnerungen, weiter zu essen oder zu trinken, oder Hilfe beim Halten von Besteck und Bechern. Andere müssen eventuell teilweise gefüttert werden. In diesem Fall reicht die Pflegeperson dem Betroffenen die Bissen an (sogenanntes Anreichen der Mahlzeiten) oder führt behutsam Löffel und Tasse, wenn eigenständiges Essen nicht (mehr) möglich ist. Wichtig ist, sich dafür genügend Zeit zu nehmen und auf das Tempo der gepflegten Person einzugehen. Während der Nahrungsaufnahme achtet die Pflegeperson auch darauf, dass der Pflegebedürftige in aufrechter Position sitzt (zur Vermeidung von Verschlucken) und ausreichend kaut und schluckt. Nach dem Essen wird gegebenenfalls der Mund gereinigt.
Zum Bereich Ernährung zählt außerdem die Unterstützung bei der Flüssigkeitsaufnahme – die Pflegeperson erinnert regelmäßig ans Trinken und stellt Getränke bereit. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dem Pflegebedürftigen mehrmals täglich einen Schluck Wasser anzubieten oder den Trinkbecher zu halten, wenn die eigene Hand nicht ruhig genug ist. Dinge wie das Einkaufen von Lebensmitteln oder das Kochen gehören nicht zur Grundpflege, sondern zur hauswirtschaftlichen Versorgung. Allerdings sorgt die Pflegeperson oft dafür, dass fertige Mahlzeiten zur richtigen Zeit bereitstehen (z.B. aufwärmen oder anrichten). In speziellen Situationen – etwa wenn eine Ernährung über Sonde nötig ist – zählt auch das Verabreichen der Sondennahrung und das Reinigen der Sonde zur Grundpflege. Generell stellt die Unterstützung beim Essen und Trinken sicher, dass der pflegebedürftige Mensch ausreichend ernährt ist und genussvoll am täglichen Essen teilnehmen kann, auch wenn er es nicht mehr alleine bewältigen würde.
Mobilität: Bewegungsunterstützung und Lagerung
Die Grundpflege umfasst schließlich alle Hilfen zur Mobilität des Pflegebedürftigen. Ziel ist, die Bewegung und selbstständige Fortbewegung so weit wie möglich zu erhalten und zu unterstützen. Die Pflegeperson hilft z.B. beim Aufstehen vom Bett und beim Zubettgehen. Wenn die Kraft zum Aufstehen oder Hinsetzen fehlt, unterstützt sie den Transfer – etwa vom Bett in einen Rollstuhl oder vom Stuhl auf die Toilette. Sie gibt stabile Hilfestellungen (z.B. einen Arm zum Abstützen) und achtet auf die richtige Technik, um beide Seiten vor Verletzungen zu schützen. Auch das Umsetzen und Umlagern im Bett gehört zur Mobilitäts-Hilfe: Regelmäßiges Wechseln der Liegeposition (mindestens alle 2-3 Stunden) ist wichtig, um Druckgeschwüre (Dekubitus) zu vermeiden. Die Pflegeperson lagert den Pflegebedürftigen z.B. mit Kissen seitlich oder richtet ihn im Bett auf, damit er bequem sitzen kann.
Beispiel: Kann ein Mensch nicht mehr allein vom Bett aufstehen, so legt die Pflegekraft zunächst die Bremse am Rollstuhl an, richtet den Bettbewohner vorsichtig auf und schwenkt die Beine über die Bettkante. Dann umfasst sie ihn fachgerecht und hilft ihm, in den Rollstuhl hinüber zu wechseln. Oft kommen dabei Transfer-Hilfsmittel zum Einsatz – zum Beispiel ein Rutschbrett oder ein Lifter, um den Vorgang sicher und rückenschonend zu gestalten. Sobald der Pflegebedürftige im Rollstuhl sitzt, wird er mit einem Rollstuhl-Tisch oder Gurt gesichert, falls nötig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dieses praktische Beispiel zeigt, wie Mobilitätshilfen in der Praxis umgesetzt werden können.
Zur Mobilität zählt auch die Begleitung beim Gehen, Stehen und Treppensteigen. Die Pflegeperson stützt den Gehenden, führt ihn oder erinnert ihn an den richtigen Gebrauch von Hilfsmitteln. Oft werden Rollator oder Gehstock eingesetzt, um dem Pflegebedürftigen mehr Stabilität zu geben. Die Pflegeperson achtet darauf, Stolperfallen zu vermeiden und bei Bedarf im richtigen Moment einzugreifen – z.B. einen Sturz zu verhindern, falls das Gleichgewicht verloren geht. Auch das Verlassen des Hauses fällt unter die Mobilitätshilfe: Begleitung beim Spaziergang an der frischen Luft oder zum Arzttermin gehört für viele pflegebedürftige Menschen dazu. So kann der Betroffene trotz Einschränkungen am Leben teilhaben. Insgesamt sorgen die Hilfen im Bereich Mobilität dafür, dass die pflegebedürftige Person möglichst mobil und aktiv bleibt, gleichzeitig aber geschützt ist und sich sicher fühlen kann.
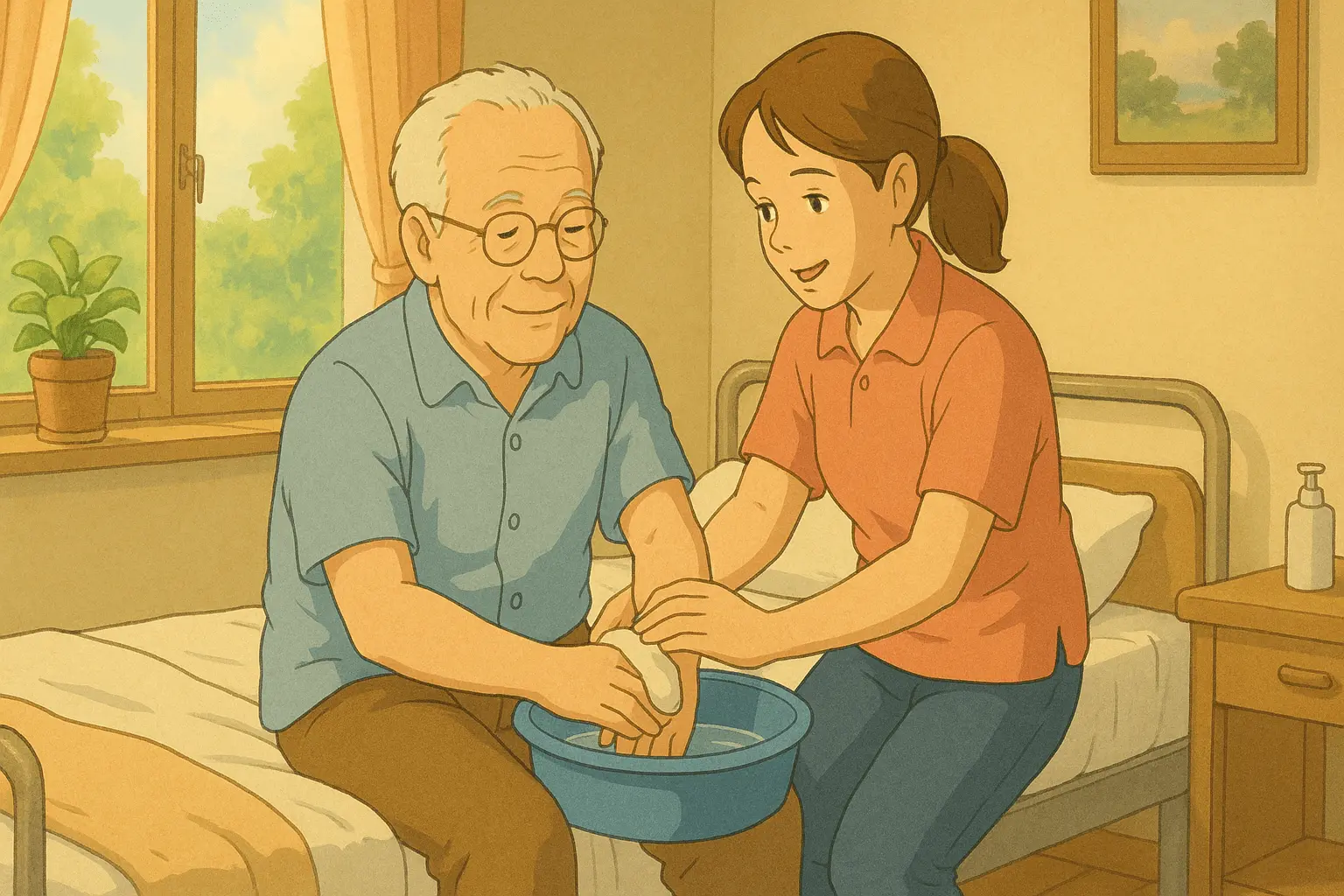
Ablauf der Grundpflege im Alltag
Wie die Grundpflege konkret abläuft, hängt vom individuellen Bedarf und Pflegegrad der Person ab. Dennoch gibt es typische Routinen, an denen man sich orientieren kann. In der Regel beginnt der Tag mit der Körperpflege am Morgen: Die Pflegeperson unterstützt den Pflegebedürftigen beim Aufstehen aus dem Bett und begleitet ihn zunächst zur Toilette (Toilettengang). Danach folgt die morgendliche Waschung bzw. Duschen oder Baden – je nach Vorlieben und Möglichkeiten. Der ablauf könnte zum Beispiel so aussehen: Zunächst Gesicht und Hände waschen, dann Oberkörper und Beine (ggf. als Teilwaschung im Bett), anschließend das Zähneputzen und Kämmen der Haare. Danach hilft die Pflegeperson beim Anziehen der Tageskleidung. Sobald die Grundpflege dieser Morgenroutine abgeschlossen ist, wird das Frühstück vorbereitet. Entweder richtet die Pflegeperson das Essen und reicht es an, oder sie leistet Unterstützung beim selbstständigen Essen (z.B. schneidet das Brot, hält Getränke bereit).
Im Verlauf des Tages fallen je nach Situation weitere pflegerische Tätigkeiten an. Beispielsweise begleitet die Pflegeperson den Pflegebedürftigen mehrmals am Tag zur Toilette oder wechselt in regelmäßigen Abständen die Inkontinenzmaterialien. Vor und nach den Mahlzeiten (Mittagessen, Abendessen) wäscht sie dem Betroffenen die Hände und leistet Hilfe beim Essen und Trinken, falls nötig. Bei Bedarf werden zwischendurch die Position im Bett geändert (Umlagern) oder kurze Ruhepausen auf dem Bett ermöglicht. Am Abend wird der ablauf der Grundpflege oft ähnlich wie am Morgen durchgeführt: Der Pflegebedürftige bekommt Hilfe beim Umziehen in Nachtwäsche, eventuell bei einer erneuten leichten Körperpflege (Waschen von Gesicht, Händen, Intimbereich) und beim Toilettengang vor dem Schlafengehen. Schließlich hilft die Pflegeperson beim Zubettgehen und sorgt dafür, dass die Person bequem und sicher liegt (z.B. mit Kissenlagerung, Bettgitter falls erforderlich). So endet der Tag mit einer abgeschlossenen Grundpflege-Routine, und der Pflegebedürftige kann sauber und versorgt schlafen gehen.
Natürlich variiert der genaue Ablauf je nach individuellen Gewohnheiten und Bedürfnissen. Wichtig ist, einen festen Rhythmus und regelmäßige Zeiten einzuhalten, da strukturierte Tagesabläufe vielen pflegebedürftigen Menschen Sicherheit geben. Pflegende Angehörige entwickeln mit der Zeit ein Gespür dafür, welche Tätigkeiten zu welcher Tageszeit am besten passen (z.B. Duschen lieber morgens, wenn die Person noch fit ist, oder abends zur Entspannung). Insgesamt sorgt ein gut geplanter Tagesablauf dafür, dass alle notwendigen Pflegetätigkeiten der Grundpflege zuverlässig erledigt werden und gleichzeitig genug Pausen und Freiräume für beide Seiten bleiben.
Zeitaufwand der Grundpflege planen
Der Zeitaufwand für die Grundpflege darf nicht unterschätzt werden. Wie viel Zeit täglich benötigt wird, hängt vom Pflegegrad und dem Gesundheitszustand der Person ab. Bei Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung) fallen oft nur unterstützende Hilfen an, die vielleicht eine Stunde pro Tag in Anspruch nehmen. Bei hohen Pflegegraden wie 4 oder 5 hingegen kann die umfassende Grundpflege mehrere Stunden täglich beanspruchen. Pflegende Angehörige sollten daher ausreichend Zeit für die Versorgung einplanen und ihren Alltag darauf einstellen. Auch in der Regel simple Tätigkeiten dauern oft länger, wenn sie mit Unterstützung erfolgen – etwa weil die Pflegeperson behutsam vorgehen muss oder Pausen eingelegt werden.
Zur Orientierung gibt es standardisierte Anhaltswerte, wie lange einzelne Tätigkeiten dauern können. Beispiel: Eine vollständige Ganzkörperwäsche im Bett benötigt etwa 20–30 Minuten, das Duschen etwa 15–20 Minuten. Die Nahrungsaufnahme mit Füttern kann pro Mahlzeit rund 20 Minuten oder mehr dauern. Hinzu kommen Vor- und Nachbereitungen – z.B. das Zimmer lüften, Materialien herrichten und hinterher alles aufräumen. Über den Tag summieren sich diese Zeiten. Bei einem pflegebedürftigen Menschen mit hohem Hilfebedarf ist es keine Seltenheit, dass pflegende Angehörige 3 bis 5 Stunden täglich mit pflegerischen Aufgaben beschäftigt sind. Dies betrifft nicht nur die direkte Durchführung der Pflege, sondern auch die Organisation drumherum (etwa Materialien besorgen, Wäsche waschen oder Dokumentation führen).
Um den Zeitaufwand besser zu managen, hilft es, einen Pflegeplan zu erstellen. Darin kann festgehalten werden, welche Pflegetätigkeiten wann anstehen und wer sie übernimmt. Ein strukturiertes Vorgehen vermeidet Hektik und stellt sicher, dass nichts Wichtiges vergessen wird. Zudem ist es ratsam, Pufferzeiten einzuplanen – gerade bei älteren Menschen kann alles etwas länger dauern als gedacht. Die Pflege sollte ohne Zeitdruck erfolgen, damit der Pflegebedürftige in Ruhe mitmachen kann und die pflegende Person sich nicht überlastet. Falls der Aufwand die Möglichkeiten der Familie überschreitet, kann über externe Unterstützung (durch Pflegedienste oder Tagespflege) nachgedacht werden – dazu später mehr im Abschnitt Entlastung für Angehörige. Zusammengefasst gilt: Lieber großzügig planen und Zeitinseln für die eigene Erholung lassen, als einen minutengenauen Zeitplan aufzustellen. So bleibt die Grundpflege machbar und menschlich, trotz aller zeitlichen Anforderungen.
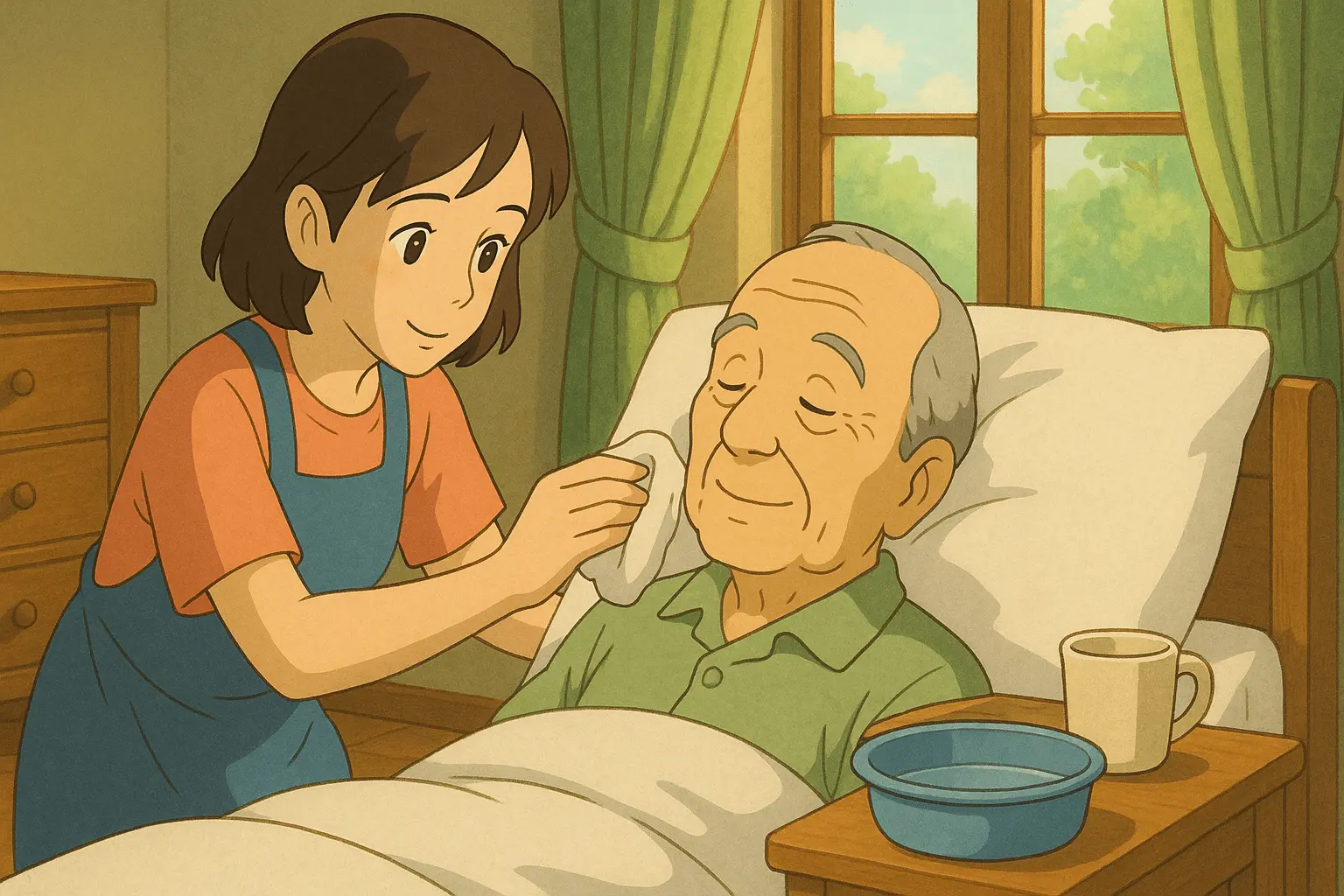
Kleine und große Grundpflege – Umfang der Unterstützung
In der Pflegepraxis wird häufig zwischen kleiner und großer Grundpflege unterschieden. Der Unterschied liegt im Wesentlichen im Umfang und Zeitaufwand, den die Pflegeperson beim Waschen und der übrigen Körperpflege aufwendet. Bei der kleinen Grundpflege kann der Pflegebedürftige noch Teile der Körperpflege selbst übernehmen und benötigt nur leichte Hilfen und Hilfestellungen. Beispiel: Eine Seniorin ist in der Lage, sich Gesicht und Oberkörper weitgehend selbst zu waschen und sich mit etwas Anleitung auch die Zähne zu putzen. Die Pflegeperson stellt ihr lediglich das Material bereit (Waschschüssel, Seife, Handtuch) und hilft vielleicht beim Waschen des Rückens oder beim Kämmen der Haare. Diese unterstützende Pflege, bei der sich der Pflegende überwiegend selbst versorgt, bezeichnet man als kleine Grundpflege. Sie umfasst oft Teilwaschungen (z.B. nur Waschen von Gesicht und Händen oder des Genitalbereichs) und punktuelle Hilfen beim Toilettengang und Ankleiden. Die Pflegekraft greift also nur dort ein, wo es nötig ist, und der Aufwand ist vergleichsweise gering.
Die große Grundpflege umfasst dagegen eine vollständige Ganzkörperwäsche und umfassende Hilfe in allen Bereichen der Körperpflege. Hier ist der Pflegebedürftige meist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu waschen oder anzuziehen. Bei der großen Grundpflege übernimmt die Pflegeperson sämtliche Pflegemaßnahmen: vom kompletten Waschen (entweder im Bett, am Waschbecken oder in der Dusche/Badewanne) über das Abtrocknen und Eincremen bis hin zum Ankleiden und Kämmen. Typischerweise beinhaltet die große Grundpflege also die Tätigkeiten der kleinen Grundpflege plus eine Vollwäsche des Körpers. Diese wird je nach Zustand des Pflegebedürftigen im Bett, im Bad oder in der Dusche durchgeführt. Da hier deutlich mehr Handlungsaufwand nötig ist, dauert die große Grundpflege entsprechend länger. Oft ist sie auch körperlich anspruchsvoller für die Pflegeperson, weil der schwer Pflegebedürftige mehr gehoben, gehalten oder bewegt werden muss.
Pflegedienste bieten die kleine und große Grundpflege oft als unterschiedliche Leistungskomplexe an – je nachdem, was im Einzelfall benötigt wird. In manchen Bundesländern gibt es leicht unterschiedliche Definitionen, welche Tätigkeiten genau zur kleinen oder großen Grundpflege gehören. In der Regel beinhaltet die große Grundpflege immer eine vollständige Körperpflege (Ganzwaschung) und oft auch das Bettenmachen und Lagern, während die kleine Grundpflege sich auf Teilbereiche beschränkt. Welchen Umfang der Einzelpflege jemand konkret braucht, entscheidet der Medizinische Dienst im Zuge der Pflegegrad-Begutachtung bzw. stellt es der Pflegebedürftige mit seinen Angehörigen fest. Wichtig ist, dass die Begriffe "klein" und "groß" keine Wertung darstellen, sondern lediglich den Umfang der notwendigen Hilfe beschreiben. Beide Formen stellen sicher, dass die tägliche Grundversorgung in angemessener Form erfolgt – je nach Selbstständigkeit der gepflegten Person mal mit mehr, mal mit weniger Unterstützung.
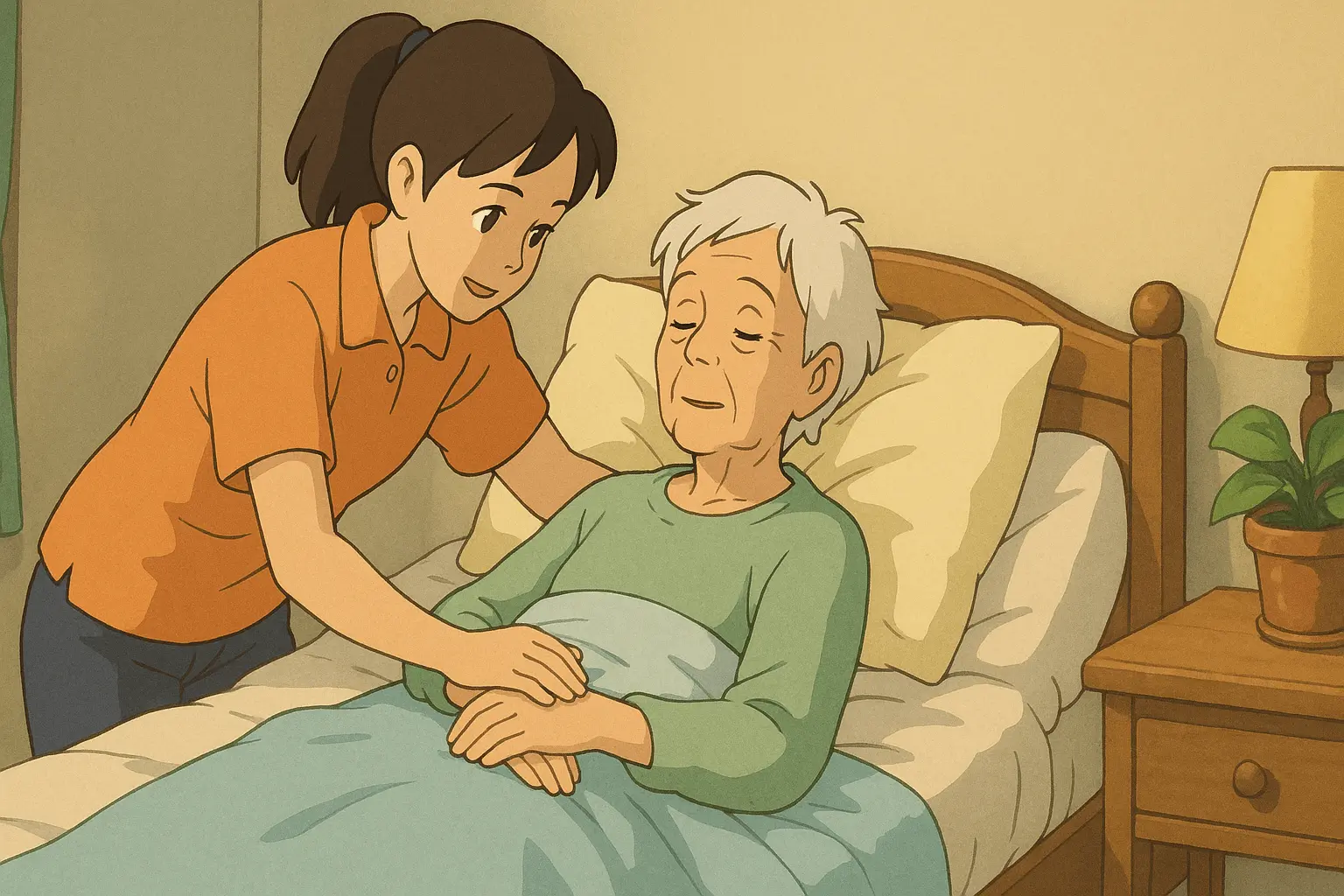
Tipps für die Grundpflege zu Hause
Die häusliche Pflege eines Angehörigen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit einigen Tipps und praktischen Maßnahmen lässt sich die Grundpflege jedoch erleichtern – sowohl für die pflegebedürftige Person als auch für die Pflegenden. Im Folgenden finden Sie Ratschläge zur Vorbereitung, zum einfühlsamen Umgang und zur Durchführung der täglichen Pflege, die sich in der Praxis bewährt haben.
Vorbereitung und Organisation der Pflege
Gute Planung ist das A und O in der Grundpflege. Bevor Sie mit einer Pflegetätigkeit beginnen, sollten Sie alle benötigten Materialien griffbereit haben. Legen Sie z.B. Handtücher, Waschlappen, Seife, Lotion, frische Wäsche (Kleidung, Unterwäsche) und ggf. Einmalhandschuhe bereit, bevor Sie mit der Körperpflege starten. Auch Hilfsmittel wie ein Duschhocker, Waschschüssel, Inkontinenzauflagen oder ein Hebekran (Lifter) sollten vorbereitet sein, falls sie benötigt werden. Diese Vorarbeit reduziert den Zeitaufwand während der Pflege und verhindert, dass der Pflegebedürftige unnötig lange warten oder frieren muss, während noch Dinge zusammengesucht werden.
Achten Sie außerdem auf eine angenehme Umgebung: Das Zimmer sollte warm genug sein (besonders während des Waschens, damit der Mensch nicht auskühlt). Schließen Sie Fenster, um Zugluft zu vermeiden, oder sorgen Sie für ausreichend Licht bei der Mobilität (z.B. beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl). Legen Sie eventuell leise beruhigende Musik auf, wenn das der Person guttut, oder sorgen Sie für Ruhe, falls Konzentration nötig ist (etwa beim Treppensteigen mit Hilfe). In der Praxis hat es sich bewährt, eine Routine zu etablieren – z.B. immer zur gleichen Tageszeit zu waschen oder Mahlzeiten bereitzustellen. So wissen alle Beteiligten, was als Nächstes kommt. Halten Sie einen Pflegeplan oder eine Checkliste bereit, auf der tägliche Aufgaben abgehakt werden können. Das schafft Struktur und stellt sicher, dass keine wichtige Pflegeleistung vergessen wird (etwa die Einnahme von Medikamenten, die allerdings zur Behandlungspflege zählt). Gute Organisation schafft einen Überblick und reduziert Stress im Pflegealltag – so können Sie sich ganz auf den Menschen konzentrieren.
Kommunikation und einfühlsamer Umgang
Ein respektvoller, einfühlsamer Umgang ist in der Pflege genauso wichtig wie die technischen Handgriffe. Viele pflegebedürftige Menschen empfinden Scham oder Unbehagen, wenn jemand anderes sehr intime Dinge übernimmt. Daher sollten Pflegekräfte und pflegende Angehörige stets behutsam und mit Würde vorgehen. Sprechen Sie mit der Person – erklären Sie jeden Schritt der Grundpflege, bevor Sie ihn durchführen. Zum Beispiel: "Ich helfe dir jetzt beim Waschen deines Rückens, ist das in Ordnung?" oder "Bitte lehnen Sie sich leicht nach vorne, damit ich das Hemd ausziehen kann." Diese laufende Kommunikation gibt dem Pflegebedürftigen ein Gefühl von Kontrolle und Beteiligung.
Achten Sie auf nonverbale Signale: Gesichtsausdruck, Körpersprache oder Lautäußerungen können viel darüber verraten, ob sich jemand unwohl fühlt, Schmerzen hat oder eine Pause braucht. Reagieren Sie darauf mit Verständnis und passen Sie Ihr Handeln an (z.B. langsamere Bewegungen, eine kurze Unterbrechung). Bewahren Sie dabei eine ruhige, freundliche Tonlage – Ungeduld oder Hektik übertragen sich leicht und verunsichern die gepflegte Person. Ein weiterer Tipp ist, die Privatsphäre so weit wie möglich zu wahren. Beispielsweise kann man während der Körperpflege immer nur die gerade zu waschenden Körperstellen entblößen und den Rest mit einem Handtuch bedecken. Dadurch fühlt sich der Mensch weniger exponiert. Bitten Sie auch Besucher oder andere Familienmitglieder, den Raum zu verlassen, wenn es dem Pflegebedürftigen unangenehm ist, vor anderen gewaschen oder umgezogen zu werden. Kurz gesagt: Behandeln Sie Ihren Angehörigen so, wie Sie selbst behandelt werden möchten – mit Respekt, Geduld und liebevoller Betreuung. Ein freundliches Wort, ein Lächeln und empathisches Zuhören können viel dazu beitragen, dass die Grundpflege nicht als belastend, sondern als normale Fürsorge empfunden wird.
Selbstständigkeit fördern: Anleitung statt Abnahme
Ein zentrales Prinzip in der Grundpflege ist die aktivierende Pflege. Das bedeutet, die pflegebedürftige Person soll so viel wie möglich selbst tun – und die Pflegeperson greift nur dort ein, wo Hilfe wirklich nötig ist. Fördern Sie daher die Selbstständigkeit Ihres Angehörigen, anstatt ihm alles abzunehmen. In der Praxis heißt das: Lassen Sie ihn alle Schritte selbst ausführen, die er noch kann, und unterstützen Sie nur bei den Teilen, die Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel kann jemand vielleicht noch selbstständig den Oberkörper waschen, benötigt aber Hilfestellung bei den Beinen. Dann reichen Sie einen feuchten Waschlappen und anleitungen denjenigen, sich Gesicht und Brust selbst zu waschen, während Sie anschließend Beine und Füße übernehmen. Loben Sie die Person für alles, was sie selbst geschafft hat – positive Bestärkung motiviert zur Mitarbeit.
Die Pflegekasse und der Gesetzgeber unterscheiden verschiedene Formen des Handelns bzw. der Hilfeleistung durch die Pflegeperson: Beaufsichtigung, Unterstützung, Anleitung, teilweise Übernahme oder vollständige Übernahme. Nicht immer ist aktives Handeln des Pflegenden nötig – manchmal genügt es, wenn er im Hintergrund beaufsichtigend zur Stelle ist. Beispiel: Der Pflegebedürftige kann sich grundsätzlich selbst kämmen oder rasieren, braucht aber ein wachsames Auge daneben, falls er unsicher wird. In diesem Fall bleibt die Pflegeperson nur daneben (Beaufsichtigung) und greift nur ein, wenn Hilfe nötig ist. In anderen Situationen reicht Anleitung: Die Pflegeperson zeigt oder erklärt eine Handlung und der Betroffene führt sie selbst aus. Unterstützung bedeutet, dass der Pflegende bei einzelnen Handgriffen mit anpackt – etwa die Zahnpasta aufträgt oder eine Tasse ansetzt – während der Rest allein gelingt. Erst wenn etwas gar nicht mehr selbstständig möglich ist, sollte es teilweise oder vollständig übernommen werden. Auch dann kann man den Pflegebedürftigen einbeziehen, z.B. ihn auffordern, den Arm zu heben, während man das Hemd auszieht, anstatt alles passiv geschehen zu lassen.
Diese aktivierende Vorgehensweise fördert die verbliebenen Fähigkeiten und vermittelt dem Menschen Sicherheit und Selbstwertgefühl. Er erlebt, dass er trotz Einschränkungen noch etwas selbst schaffen kann. Für pflegende Angehörige bedeutet das zwar anfangs mehr Geduld (denn es dauert länger, wenn der Betroffene selbst mitmacht). Aber auf lange Sicht kann es Arbeit ersparen, denn Fähigkeiten bleiben länger erhalten und der Pflegebedürftige bleibt mobiler und kooperativer. Merke: Immer Hilfestellungen zur Selbsthilfe geben, anstatt vorschnell alles abzunehmen. So bleibt die Grundpflege ein Miteinander statt ein einseitiges Handelns der Pflegeperson.
Eigene Gesundheit der Pflegeperson erhalten
Vergessen Sie bei aller Fürsorge nicht sich selbst – die Pflegeperson. Häusliche Pflege kann körperlich und seelisch sehr fordernd sein. Achten Sie daher unbedingt auf Ihre eigene Gesundheit und holen Sie sich Unterstützung, wenn nötig. Ergonomisches Arbeiten ist ein wichtiger Aspekt: Lernen Sie richtige Hebe- und Tragetechniken, um Ihren Rücken zu schonen. Beim Umbetten oder Aufstehen des Pflegebedürftigen sollten Sie, wenn möglich, Hilfsmittel verwenden (z.B. Transferbrett, Rollgurt oder Lifter), um sich nicht zu überlasten. Viele Pflegekassen bieten kostenlose Pflegekurse oder Schulungen an, in denen pflegende Angehörige den praktischen Umgang – etwa rückenschonendes Betten und Heben – unter Anleitung von Pflegekräften üben können. Scheuen Sie sich nicht, solche Angebote wahrzunehmen; sie können im Alltag enorme Erleichterung bringen.
Ebenso wichtig ist es, psychische Belastungen auszugleichen. Gönnen Sie sich regelmäßige Pausen und Auszeiten. Niemand kann 24 Stunden am Tag in der Betreuung präsent sein, ohne selbst auszubrennen. Nutzen Sie Entlastungsangebote: Zum Beispiel können Sie die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen – das bedeutet, die Pflegeversicherung finanziert eine Ersatzpflege (durch einen Pflegedienst oder im Pflegeheim), wenn Sie selbst Urlaub machen oder krank werden. Auch die Tagespflege ist eine Option: Hier verbringt der Pflegebedürftige einige Stunden am Tag in einer Betreuungseinrichtung, was Ihnen Zeit für sich verschafft. Darüber hinaus steht jedem Pflegehaushalt ein monatlicher Entlastungsbetrag (125 Euro) zur Verfügung, der für Angebote wie eine Haushaltshilfe, einen Alltagsbegleiter oder eine Betreuungsgruppe verwendet werden kann. Informieren Sie sich bei Ihrer Pflegekasse über diese Leistungen – sie sollen Sie ausdrücklich entlasten und sind Teil des Systems.
Zögern Sie auch nicht, im Familien- und Freundeskreis um Hilfe zu bitten. Vielleicht können Geschwister, Kinder oder Nachbarn einzelne Aufgaben übernehmen (zum Beispiel Besorgungen erledigen, mal für ein paar Stunden Aufsicht führen oder mit dem Pflegebedürftigen spazieren gehen). Eine Pflegeperson muss nicht alles alleine stemmen. Vernetzen Sie sich auch gern mit anderen Pflegenden – in Selbsthilfegruppen oder online-Foren können Sie Erfahrungen austauschen und wertvolle Tipps erhalten. Und ganz wichtig: Pflegen Sie Ihre eigene Gesundheit, gehen Sie zu Vorsorgeuntersuchungen, planen Sie kleine Erholungsmomente in den Tag ein. Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie auf Dauer gut für Ihren Angehörigen sorgen. Die Grundpflege soll kein Dauer-Notfallmodus sein, sondern gut organisiert und im regelmäßigen Rhythmus stattfinden – und dazu gehört auch, dass die pflegende Person sich Pausen und Unterstützung gönnt.

RATGEBER
Barrierefreier Badumbau: Mit diesen Kosten sollten Sie rechnen
Mehr erfahren →Grundpflege vs. Behandlungspflege – der Unterschied
Ein häufiges Missverständnis in der häuslichen Pflege betrifft die Abgrenzung von Grundpflege und Behandlungspflege. Während die Grundpflege – wie oben beschrieben – die Unterstützung bei den grundlegenden Alltagsverrichtungen (Körperpflege, Ernährung, Mobilität, Ausscheidung) umfasst, handelt es sich bei der Behandlungspflege um medizinische Pflegemaßnahmen. Beispielsweise gehört zur Behandlungspflege alles, was ein Arzt an konkreten medizinischen Tätigkeiten verordnet: Verbandswechsel, Wundversorgung, Medikamentengabe, Injektionen (Spritzen), Blutdruckmessen oder Blutzuckerkontrollen, Versorgung von Drainagen, Bedienung von Infusionen oder Beatmungsgeräten usw.. Diese Tätigkeiten dienen unmittelbar der Behandlung von Krankheiten, der Linderung von Symptomen oder der medizinischen Sicherheit des Patienten. Sie erfordern in der Regel fachliche Kompetenz und müssen von ausgebildeten Pflegekräften (Gesundheits- und Krankenpfleger/innen) durchgeführt werden.
Die Behandlungspflege ist somit deutlich von der Grundpflege zu unterscheiden. Gesetzlich ist sie in SGB V geregelt und Teil der häuslichen Krankenpflege. Die Krankenversicherung (gesetzliche Krankenkasse) übernimmt die Kosten der Behandlungspflege, wenn sie vom Arzt verordnet wird. In der Regel kommt die Behandlungspflege zum Einsatz, wenn jemand zwar keine eingestufte Pflegebedürftigkeit hat oder neben der Grundpflege zusätzlich zeitlich begrenzte medizinische Hilfe braucht – etwa nach einem frischen Krankenhausaufenthalt oder bei bestimmten Krankheitsbildern. Beispiel: Nach einer schweren Operation kann der Arzt für einige Wochen häusliche Krankenpflege verordnen, sodass ein Pflegedienst z.B. täglich den Verbandswechsel und die Grundpflege übernimmt. In diesem Fall zahlt die Krankenversicherung diese Leistungen vorübergehend (der Patient muss nur eine geringe Zuzahlung leisten). Dauert der Pflegebedarf länger an und wird als Pflegebedürftigkeit eingestuft, ist wiederum die Pflegeversicherung (SGB XI) für die Grundpflege zuständig.
Kurz gesagt: Die Grundpflege betrifft die alltägliche Versorgung und wird im Rahmen der Pflegeversicherung gewährt, Behandlungspflege betrifft medizinische Maßnahmen und läuft über die Krankenversicherung. In vielen Pflegearrangements treten beide Komponenten nebeneinander auf – zum Beispiel erhält ein Pflegebedürftiger Leistungen der Grundpflege (Waschen, Anziehen etc.) durch Angehörige oder Pflegedienst und zusätzlich Besuch vom ambulanten Pflegedienst für eine Injektion oder Wundversorgung am Tag. Ein guter Pflegedienst kann beides leisten, aber die Abrechnung erfolgt getrennt nach den jeweiligen Versicherungsträgern. Für pflegende Angehörige ist es wichtig, diesen Unterschied zu kennen: Grundpflege kann man oft selbst übernehmen (dafür gibt es Pflegegeld), Behandlungspflege sollte hingegen dem medizinischen Fachpersonal überlassen werden. Bei Unsicherheit berät der Hausarzt oder Pflegedienst, was in die jeweilige Kategorie fällt. So bekommt der Pflegebedürftige die optimale Mischung aus persönlicher Betreuung und professioneller medizinischer Pflege.
Unterstützung und Entlastung für pflegende Angehörige
Die Pflege eines Menschen zu Hause ist eine große Aufgabe – doch niemand muss sie ganz allein bewältigen. Es gibt zahlreiche Hilfen und Angebote, um pflegende Angehörige zu unterstützen und zu entlasten. Zunächst kann man einen ambulanten Pflegedienst flexibel hinzuziehen. Dieser kann z.B. an ein oder zwei Tagen pro Woche die Grundpflege (etwa das Baden oder Duschen) übernehmen, wenn es für die Familie zu anstrengend ist. Auch Einsätze nur für bestimmte Tätigkeiten – wie das Anlegen von Kompressionsstrümpfen morgens oder die Abendtoilette – sind möglich. Die Kosten dafür können über die Pflegesachleistungen der Pflegeversicherung abgedeckt werden, solange der monatliche Höchstbetrag des jeweiligen Pflegegrades nicht überschritten wird. Die Kombination aus familiärer Pflege und Pflegedienst-Einsätzen kann sehr entlastend sein und sicherstellen, dass auch anspruchsvollere Pflegetätigkeiten fachgerecht durchgeführt werden.
Neben Pflegediensten gibt es die Möglichkeit der Tagespflege. Dabei wird der Pflegebedürftige tagsüber stundenweise in einer Einrichtung betreut (zum Beispiel in einem Senioren-Tageszentrum) und kehrt abends nach Hause zurück. Dort erhält er Betreuung, Grundpflege, Mahlzeiten und soziale Aktivitäten, während die Angehörigen Zeit für Beruf oder Erholung haben. Die Kosten der Tagespflege trägt die Pflegeversicherung zusätzlich zum Pflegegeld (ab Pflegegrad 2) – ein oft wenig bekanntes Leistungsangebot. Für kurzfristige Entlastung steht außerdem die Kurzzeitpflege zur Verfügung: Hier kann der Pflegebedürftige vorübergehend (bis zu 8 Wochen im Jahr) in einem Pflegeheim gepflegt werden, etwa wenn die Angehörigen Urlaub machen oder selbst erkranken. Auch diese Kosten übernimmt die Pflegeversicherung bis zu bestimmten Beträgen.
Eine wichtige Unterstützung ist die bereits erwähnte Verhinderungspflege. Sie greift, wenn die Haupt-Pflegeperson vorübergehend verhindert ist (durch Urlaub, Krankheit oder andere Gründe). In dieser Zeit kann ein Ersatz – etwa ein ambulanter Dienst oder eine andere Privatperson – die Pflege übernehmen, und die Pflegekasse erstattet die Kosten bis zu 1.612 Euro pro Jahr (ggf. plus Kurzzeitpflegebudget). Dieses Instrument gibt Angehörigen die Möglichkeit, auch mal frei zu haben, ohne dass die Versorgung des Pflegebedürftigen leidet.
Pflegende Angehörige sollten auch den Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich nicht verfallen lassen. Damit können z.B. Alltagsbegleiter, Betreuungsgruppen (etwa für Demenzkranke) oder haushaltsnahe Dienstleistungen finanziert werden. Viele Wohlfahrtsverbände oder lokale Initiativen bieten Betreuungsnachmittage, Besuchsdienste oder Helferkreise an, die über diesen Betrag abgerechnet werden können. So bekommt der Pflegebedürftige Abwechslung und Gesellschaft, und der Angehörige hat ein paar Stunden für sich.
Nicht zuletzt gibt es professionelle Beratungsangebote: Jede Pflegekasse vermittelt kostenlose Pflegeberatungen (§7a SGB XI) durch geschulte Pflegeberater. Diese können individuelle Lösungen aufzeigen und bei der Organisation der Hilfe zur Seite stehen. Zudem sind Pflegende verpflichtet, ab Pflegegrad 2 halbjährlich (bzw. vierteljährlich ab Grad 4) einen Beratungsbesuch abzurufen – dieser dient nicht der Kontrolle, sondern der Qualitätssicherung und der fachlichen Unterstützung der häuslichen Pflege. Nutzen Sie solche Besuche, um Fragen zu stellen und Tipps zu erhalten.
Wichtig ist insgesamt, Hilfe anzunehmen. Die Pflege eines Angehörigen kann sonst schnell zur Überforderung führen. Dank der Sozialgesetzgebung in Deutschland stehen jedoch vielfältige Hilfen bereit. Ob ambulante Pflegekräfte, teilstationäre Angebote oder finanzielle Leistungen – pflegende Angehörige müssen kein schlechtes Gewissen haben, diese Ressourcen zu nutzen. Im Gegenteil: Sie handeln verantwortungsvoll, wenn Sie für sich selbst sorgen und Überlastung vorbeugen. Nur so können Sie langfristig für Ihren Nächsten da sein. Im Zusammenspiel von familiärer Zuwendung und professioneller Unterstützung lässt sich die Grundpflege zu Hause gut bewältigen. Zögern Sie also nicht, Anspruch auf Entlastungsleistungen geltend zu machen und bei Bedarf auch mal "Nein" zu sagen, um die eigene Kraft zu erhalten. Pflege ist ein Teamwork – innerhalb der Familie und mit dem Pflegesystem.
Kostenlose Pflegehilfsmittel
Schon ab Pflegegrad 1 stehen Ihnen Hilfsmittel im Wert von €42 pro Monat zu.
Jetzt beantragen
Fazit
Die Grundpflege bildet die Grundlage der Versorgung pflegebedürftiger Menschen – sie sichert Grundbedürfnisse wie Sauberkeit, Ernährung, Mobilität und Ausscheidung im Alltag. Mit fachgerechter Durchführung, Einfühlungsvermögen und guter Organisation kann die Grundpflege zu Hause würdevoll und effektiv gestaltet werden. Wichtig ist, den Pflegebedürftigen stets einzubeziehen und zur Selbstständigkeit anzuleiten, statt ihm alles abzunehmen. Die Pflegeperson ihrerseits sollte auch auf sich selbst achten und verfügbare Hilfen in Anspruch nehmen. Dank Leistungen der Pflegeversicherung (Pflegegeld, Sachleistungen etc.) und Entlastungsangeboten muss niemand diese Aufgabe alleine stemmen. Letztendlich geht es bei der Grundpflege darum, dem pflegebedürftigen Menschen ein Leben in Würde, Sicherheit und so viel Eigenständigkeit wie möglich zu ermöglichen – und zwar in der vertrauten Umgebung zu Hause, mit Unterstützung durch liebevolle Angehörige und professionelle Helfer im Hintergrund. Mit Wissen, Geduld und gegenseitiger Hilfe kann diese Herausforderung gemeistert werden, im besten Interesse der gepflegten Person und ihrer Familie.

RATGEBER
So viel kostet ein Sitzlift in 2025
Mehr lesen →Die häufigsten Fragen im Überblick
Die wichtigsten Fragen & Antworten zum Thema, die häufig von unseren Nutzern gestellt werden.











